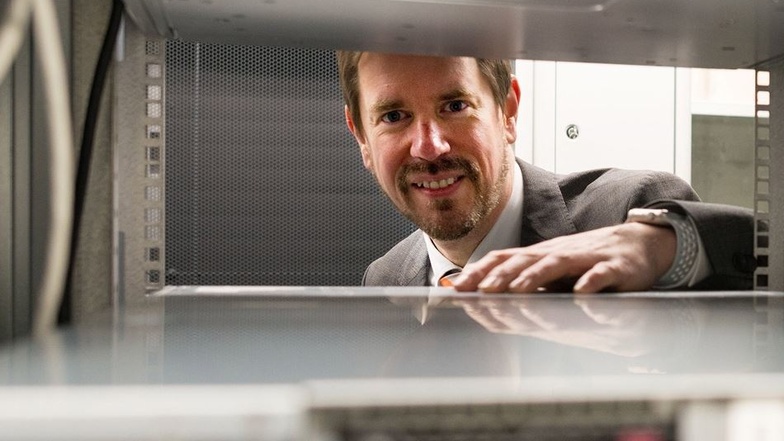Von Annechristin Bonß
Nur ein kleiner Piks. Tut nicht weh. Trotzdem guckt der Patient weg. Schon läuft das Blut ins Röhrchen. Gleich vorbei. Kanüle raus. Pflaster drauf. Was nur wenige Sekunden dauert, bringt nicht nur dem Arzt Gewissheit über die Gesundheit des Patienten. Hier werden Daten gesammelt. Daten, wie sie in der Medizin millionenfach anfallen. Hier ein Röntgenbild, dort ein Medikamentenplan. Hier die genetische Auswertung einer entnommenen Gewebeprobe, dort eine Stuhlprobe. Überall sammeln Mediziner Daten und stellen auf dieser Grundlage Diagnosen.
Für Martin Sedlmayr können die Daten noch mehr. Der 44-Jährige ist kein Mediziner. Er ist Informatiker. Und vorgesehen für die neue Professur für Medizinische Informatik an der TU Dresden. Blutabnehmen muss er nicht. Seine Aufgaben ist die Digitalisierung der Medizin in Dresden. Big Data ist im Krankenzimmer angekommen. Es geht um die Frage, wie sich Technologien und Programme sinnvoll gestalten lassen, damit Mediziner und Pfleger mit den Zahlen arbeiten können. Mit Tausenden Zahlen. Auch, wenn die Ärzte mit Informatik so gar nichts zu tun haben, weil sie sich für einen nicht so technischen Beruf entschieden haben. „Selbst normale Computer stoßen bei solch einer Datenmenge an ihre Grenzen“, sagt Martin Sedlmayr.
So fallen für einen Patienten in der Intensivmedizin zum Beispiel zehn- bis fünfzehntausend Datenelemente pro Tag an. Unentwegt laufen die Monitore, werden Herzschlag, Atmung und Sauerstoffgehalt im Blut überwacht. Der Datensatz für eine Gendiagnostik kann gut und gerne einmal 500 Gigabyte groß sein. Das ist mehr als manch Computer zu Hause an freiem Speicherplatz hat. Und die Datenmenge pro Patient steigt unentwegt. Nicht nur durch die medizinischen Parameter. Lärm und Abgase haben einen Einfluss auf den Körper, genau wie Bewegung, Ernährung und Alkoholgenuss. „Daher macht es Sinn, dass dem Arzt auch diese Informationen zur Verfügung stehen“, sagt der Informatiker.
Die Computer müssen die Daten lesen, verstehen und vergleichen. Und im Zweifel die Rechte des Patienten wahren. Dessen Anonymität muss gesichert sein. Ärzte und Forscher müssen ethisch, rechtlich und sozial vertretbar mit den Daten umgehen. „Niemand darf leichtfertig mit den Patientendaten umgehen, der Nutzung sind enge Grenzen gesetzt“, sagt der Wissenschaftler. „Der Patient bleibt Herr seiner Daten. “ Vorgaben für das Einwilligungsmanagement zählen ebenfalls zu seinem Gebiet.
Doch der Aufwand lohnt sich. Ärzte können mit den digitalen Rechenspielen Leben retten. „Zum Beispiel reagieren Tumorzellen nur auf bestimmte Medikamente“, sagt Martin Sedlmayr. Ob eine Krebszelle für eine bestimmte Therapie empfänglich ist oder nicht, wissen Mediziner mitunter erst danach. Können sie aber die Zellen vergleichen mit denen anderer Patienten, bei denen ein bestimmtes Medikament bereits angeschlagen hat, kann die Therapie individuell abgestimmt werden. Die zentrale Frage: Was hat der Patient mit anderen gemeinsam und worin unterscheidet er sich?
Je mehr Patientendaten in einem solchen Rechenprogramm zur Verfügung stehen, desto höher sind die Erfolgsaussichten für die Heilung des Einzelnen. Ähnliche Impulse erhoffen sich die Mediziner bei seltenen Erkrankungen. Jeder Datensatz mehr hilft beim Lesen und Erkennen der Symptome. Wissen, was passieren wird – so lautet die Devise für die Medizin von morgen. Für seine Arbeit trifft Martin Sedlmayr Ärzte und Pfleger. „Wir müssen wissen, was die Anwender im Umgang mit den Daten brauchen, was sie wissen wollen“, sagt er. Die Zeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Große Datenmengen müssen zeitnah und extrem schnell ausgewertet werden, innerhalb von Sekunden. Schließlich geht es um das Leben der Patienten. Der Forscher entwickelt Programme zur Verarbeitung der Daten. Und gibt Hilfe, damit Ärzte damit arbeiten können.
An der TU Dresden findet Martin Sedlmayr gute Voraussetzungen. 2015 ging der Hochleistungsrechner in Betrieb. Die Anlage war damals bereits 100 Mal schneller als der bisherige Supercomputer an der Universität. Damit sind eine Billiarde Rechenoperationen pro Sekunde möglich. Das ist eine Eins mit 15 Nullen. Operationen, die auch mit medizinischen Daten rechnen. Nicht nur Informatiker nutzen den Hochleistungsrechner. Auch Chemiker, Physiker und Biologen profitieren davon. Und schon wird ein noch schnellerer, größerer Nachfolger des Rechners geplant.
Die Politik hat für diese Herausforderung in der Medizin ein eigenes Programm aufgelegt. Überall in Deutschland sollen Datenintegrationszentren entstehen. Dort arbeiten Mediziner technisch und organisatorisch mit den Daten der Patienten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung investiert bis zu 150 Millionen Euro in das Förderkonzept Medizininformatik. Martin Sedlmayr will künftig mit dem Zentrum und den IT-Fachleuten aus dem Uniklinikum und der medizinischen Fakultät zusammenarbeiten. Noch steht Deutschland hinter Ländern wie Schweden, Finnland und den USA. Dort sind die Mediziner weiter, wenn es um Big Data in der Medizin geht. In Australien, wo mitunter viele Hundert Kilometer den Patienten vom Arzt trennen, wird die Telemedizin vorangetrieben. Basierend auf schneller Datenübertragung und Auswertung. In Afrika funktioniert dies sogar über die Grenzen des Kontinents hinweg. Ärzte in Harvard helfen einigen Patienten via Telekommunikation.
Der Piks tut nicht mehr weh. Alles gut. Wieder ein paar Daten mehr. Daten, die den Ärzten beim Heilen helfen.