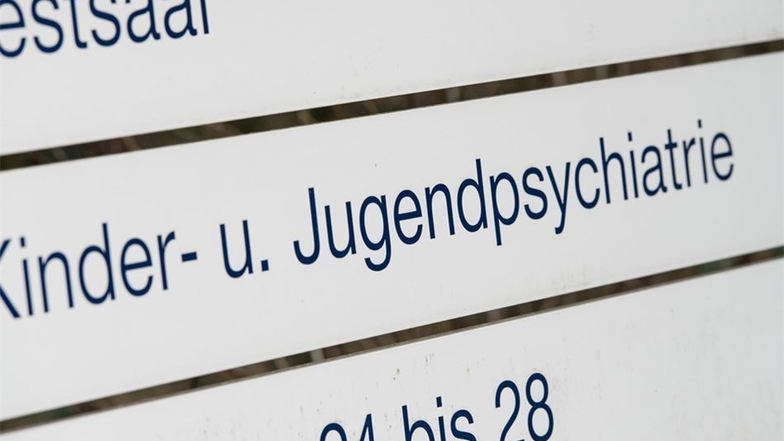Jörg Schurig
Dresden. Mit starken Aufmerksamkeitsdefiziten und einer Lese-Rechtschreibschwäche kommt D. in der Schule nur schlecht mit. Die Probleme wirken sich auf das emotionale Wohlbefinden des 13-Jährigen aus. Es mangelt ihm an Selbstbewusstsein, er gilt als Außenseiter. Abends kann er oft nicht einschlafen. Seine Familie hat deshalb professionelle Hilfe gesucht und sich bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Chemnitz lange um einen Termin bemüht - erfolglos. Schließlich halfen die Kollegen in Dresden weiter. Aber auch das dauerte noch einmal Wochen.
Lange Wartezeiten für Betroffene und schwierige Arbeitsbedingungen für das Personal: Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Sachsen bleibt ein Sorgenkind. „Wir haben Wartezeiten in ganz Deutschland. Aber in Sachsen ist es besonders schwierig, vor allem im ländlichen Raum“, sagt Renate Schepker, Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden Klinikärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Es mangele in Sachsen nicht unbedingt an stationären Plätzen - aber an Personal.
„Aus Sicht unserer Fachgesellschaft muss mehr getan werden, um das System attraktiv zu machen“, erklärt die Professorin. Ende 2016 habe ihr Fachverband einen offenen Brief an das sächsische Sozialministerium geschrieben und Lösungen unterbreitet. Die Situation habe sich leider nicht verbessert. „Man tut so, als ob man etwas tut.“ Schepker verweist darauf, dass im Ministerium mit Headhuntern zwar gezielt nach Ärzten für diesen Bereich gesucht werde. Allerdings hätten sich die Arbeitsbedingungen vor Ort nicht verbessert: „Das führt zu einem ständigen Wechsel beim Personal.“
Die hohe Fluktuation macht die Wartezeiten noch länger. Das gilt vor allem für die kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken in Arnsdorf bei Dresden, Rodewisch und Mittweida. Dort müssen Eltern oft mehrere Monate auf einen Termin für ihre Kinder und noch länger auf einen stationären Behandlungsplatz warten. „Für ein Kind ist eine Wartezeit von drei Monaten vielleicht gerade noch hinnehmbar, ein halbes Jahr aber ist definitiv zu lang“, sagt Schepker. Denn in einem solchen Zeitraum finde „ganz viel Entwicklung“ statt. Zudem sei die ambulante Versorgung mangelhaft. Auch die wenigen niedergelassenen Kollegen könnten es nicht richten - selbst wenn sie ihr Bestes gäben.
Dabei lassen sich viele Probleme gerade bei Kindern und Jugendlichen nicht auf die lange Bank schieben. Generell gilt: Je eher eine Störung behandelt wird, desto besser. „Bei den schweren Störungen zählt auch die Qualität der Erstbehandlung“, sagt Schepker. Deshalb seien nicht zuletzt ständige Investitionen in die Fortbildung erforderlich. Sachsen stehe dem nicht ohnmächtig gegenüber. „Es gibt 1001 Ideen. Der Freistaat könnte sich externe Beratung und Coaching kaufen. Man könnte regionale Fachweiterbildungen machen. Es gibt viele Modelle, Ärzte zu werben und auch die Möglichkeit, mit Universitäten zusammenzuarbeiten.“
Im sächsischen Sozialministerium sieht man die Lage durchaus kritisch - im Vergleich zur Situation vor einem Jahr geht man hier allerdings von einer Verbesserung aus. Personalprobleme gebe es vor allem bei Fachärzten und hier besonders in der Klinik in Mittweida, heißt es aus dem Ressort von Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU): „Der Freistaat Sachsen kann einen Ärztemangel nicht aktiv beheben, sondern lediglich Anreize setzen, die perspektivisch geeignet sind, die Situation abzumildern.“ Das Ministerium will in Abstimmung mit der Landesärztekammer und anderen nun ein Modellprojekt zur Weiterbildung auch in der KJP auflegen und hofft auf Zuspruch. (dpa)